
Herr Dr.med. Holger Groß Facharzt fur Orthopädie und Sportmedizin, Schulter- und Kniechirurgie, Ambulante Operationen
Allg. Sprechstunde: +49.6831.3100 +49.6831.5031792 info@dr-gross.deDie Patellainstabilität ist eine häufige orthopädische Herausforderung, die sowohl junge als auch ältere Patienten betreffen kann. Sie entsteht durch eine unzureichende Führung der Kniescheibe (Patella) im Gleitlager des Oberschenkelknochens, der sogenannten Trochlea. Dabei kann die Patella aus ihrer Position herausrutschen, was häufig mit Schmerzen, Schwellungen und einer eingeschränkten Beweglichkeit einhergeht. Besonders belastend für Betroffene sind wiederholte Luxationen, bei denen die Kniescheibe meist nach außen (lateral) springt, und die langfristig zu dauerhaften Knorpelschäden und Arthrose führen können.
Die Patella spielt eine zentrale Rolle für die Biomechanik des Knies. Als größtes Sesambein im menschlichen Körper wirkt sie wie ein Hebel, der die Kraft des Quadrizepsmuskels auf die Streckbewegung des Beins überträgt. Ihre Stabilität ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels aus knöchernen Strukturen, Weichteilen wie Bändern und Muskeln sowie der Dynamik der gesamten Beinachse. Eine Störung in einem dieser Bereiche kann die Stabilität der Patella beeinträchtigen.
Die Ursachen der Patellainstabilität sind vielfältig und oft multifaktoriell. Eine wichtige Rolle spielt die Anatomie des Kniegelenks. Eine flache oder schlecht ausgeprägte Trochlea, die normalerweise wie ein Führungskanal für die Kniescheibe funktioniert, kann dazu führen, dass die Patella leichter aus ihrer Position gleitet. Ebenso kann eine Patella alta, also eine zu hoch stehende Kniescheibe, das Risiko für Instabilität erhöhen. Beide Veränderungen begünstigen, dass die Kniescheibe vor allem bei starker Beugung des Knies nicht mehr optimal in der Trochlea gehalten wird.
Auch die Weichteile um das Knie beeinflussen die Stabilität der Patella. Insbesondere das mediale patellofemorale Ligament (MPFL), das die Kniescheibe nach innen stabilisiert, ist oft betroffen. Bei einer Luxation wird dieses Band häufig gedehnt oder reißt, was die Stabilität weiter verringert und das Risiko für erneute Luxationen erhöht. Zusätzlich können muskuläre Dysbalancen, wie eine Schwäche des Quadrizepsmuskels oder ein dominanter Zug des äußeren Muskelanteils, zu einer Verschiebung der Patella nach außen beitragen.
Die erste Luxation der Patella tritt häufig im Zusammenhang mit einer plötzlichen Belastung oder einem Trauma auf, etwa bei einem Sturz oder einer abrupten Richtungsänderung im Sport. Typisch ist ein plötzliches Herausspringen der Kniescheibe, begleitet von Schmerzen und einer sichtbaren Fehlstellung. Oft ist das Knie stark geschwollen, da es zu einer Einblutung in das Gelenk kommen kann.
Wiederholte Luxationen oder Subluxationen, bei denen die Patella nur teilweise aus der Trochlea herausrutscht, führen langfristig zu Schäden am Gelenkknorpel. Die ständigen Mikrotraumata können Arthrose im Patellofemoralgelenk verursachen, die mit Schmerzen, Steifigkeit und einer eingeschränkten Beweglichkeit einhergeht. Diese chronischen Veränderungen beeinträchtigen nicht nur den Alltag, sondern auch die Fähigkeit, sportlichen Aktivitäten nachzugehen.
Die Diagnostik der Patellainstabilität beginnt mit einer gründlichen Anamnese, bei der vor allem nach früheren Luxationen, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen gefragt wird. Die klinische Untersuchung ist essenziell, um Faktoren wie die Beweglichkeit, die Beinachse und die Stabilität der Bänder zu beurteilen. Tests wie der „Apprehension-Test“, bei dem der Untersucher die Kniescheibe vorsichtig nach außen schiebt, können das Gefühl der Unsicherheit und die Angst des Patienten vor einer erneuten Luxation aufzeigen.
Bildgebende Verfahren spielen eine zentrale Rolle in der Diagnostik. Röntgenaufnahmen des Knies in verschiedenen Ebenen ermöglichen die Beurteilung der knöchernen Strukturen und können Fehlstellungen wie eine Patella alta oder eine flache Trochlea sichtbar machen. Eine Magnetresonanztomographie (MRT) ist besonders nützlich, um Weichteilschäden wie Risse des MPFL oder Knorpelschäden zu diagnostizieren. In komplexen Fällen kann eine Computertomographie (CT) mit 3D-Rekonstruktion helfen, die genaue Anatomie und eventuelle Knochendefekte besser zu analysieren.
Die Therapie der Patellainstabilität hängt von der Schwere der Instabilität und den zugrunde liegenden Ursachen ab. Nach der ersten Luxation kann häufig eine konservative Behandlung durchgeführt werden. Diese umfasst Physiotherapie zur Kräftigung der stabilisierenden Muskulatur, insbesondere des Quadrizeps, sowie die Anwendung von Orthesen oder Tapes, um die Patella zu stabilisieren. Begleitend können entzündungshemmende Medikamente und Kühlung die Schmerzen und Schwellungen lindern.
Wenn es trotz konservativer Maßnahmen zu wiederholten Luxationen kommt, ist oft eine operative Therapie notwendig. Das Ziel der Operation ist es, die Stabilität der Patella dauerhaft wiederherzustellen und weitere Schäden am Knie zu verhindern. Eine häufig durchgeführte Methode ist die Rekonstruktion des MPFL, bei der eine Sehne als Transplantat verwendet wird, um die Funktion des beschädigten Bandes zu ersetzen. Bei ausgeprägten knöchernen Fehlstellungen kann zusätzlich eine Trochleaplastik durchgeführt werden, bei der die Trochlea vertieft wird, um der Patella besseren Halt zu geben. Eine weitere Option ist die Versetzung der Tuberositas tibiae, um die Zugrichtung der Patella zu verändern.
Nach einer Operation ist eine strukturierte Nachbehandlung entscheidend für den Behandlungserfolg. In den ersten Wochen wird das Knie meist durch eine Orthese geschützt, die eine kontrollierte Mobilisierung erlaubt. Parallel dazu beginnt die Physiotherapie, die schrittweise die Beweglichkeit und die Muskelkraft wiederherstellt. Die vollständige Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten ist in der Regel nach etwa sechs bis zwölf Monaten möglich.
Langfristig können viele Patienten durch eine konsequente Therapie eine stabile und schmerzfreie Kniegelenksfunktion erreichen. Insbesondere bei frühzeitiger Behandlung und einer individuell angepassten Therapie ist die Prognose günstig. Dennoch bleibt die Vermeidung erneuter Luxationen ein zentrales Ziel, da wiederholte Verletzungen die Entwicklung von Arthrose fördern können.
Die Patellainstabilität erfordert eine sorgfältige Diagnostik und eine individuell angepasste Therapie, um langfristige Schäden zu vermeiden. Mit modernen konservativen und operativen Behandlungsmethoden stehen heute effektive Möglichkeiten zur Verfügung, die Stabilität der Patella wiederherzustellen und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich zu verbessern.
Hilfe mein Kind läuft mit den Zehen nach innen und stolpert über die eigenen Füße -
Das innenrotierte Gangbild bei Kindern (Intoeing): Eine ungefährliche Normvariante
Das innenrotierte Gangbild, auch als „Intoeing“ bezeichnet, ist ein häufig beobachtetes Phänomen bei Kindern. Dabei zeigen die Fußspitzen beim Gehen nach innen statt nach vorne. Viele Eltern sind besorgt, wenn sie diese Gehweise bei ihrem Kind bemerken, und befürchten, dass eine Fehlstellung oder ein ernsthafter orthopädischer Defekt vorliegt. Tatsächlich ist Intoeing in den meisten Fällen eine harmlose Normvariante, die keine Therapie erfordert und sich mit der Zeit von selbst korrigiert.
Intoeing resultiert aus einer leichten Verdrehung in den unteren Extremitäten, die in verschiedenen Abschnitten auftreten kann:
Das innenrotierte Gangbild tritt häufig im frühen Kindesalter auf, besonders während der ersten Jahre nach Beginn des Laufens. In der Regel erreicht es seinen Höhepunkt im Alter von 2 bis 4 Jahren und bessert sich danach schrittweise.
In den meisten Fällen ist Intoeing eine vorübergehende Erscheinung, die keine Schmerzen verursacht und die Entwicklung des Kindes nicht beeinträchtigt. Es gehört zur natürlichen Variation der kindlichen Entwicklung und ist meist eine normale Anpassung des Bewegungsapparats während des Wachstums.
Intoeing ist keine Krankheit und erfordert in der Regel keine Behandlung.
Obwohl Intoeing in der Regel harmlos ist, gibt es seltene Fälle, in denen eine ärztliche Untersuchung sinnvoll ist, insbesondere wenn:
In den meisten Fällen ist keine Behandlung erforderlich. Das Gangbild korrigiert sich durch das natürliche Wachstum von selbst. Orthopädische Schuhe, Einlagen oder Schienen, die früher häufig eingesetzt wurden, sind nach aktuellem Wissensstand meist nicht notwendig. Bei seltenen, schwereren Ausprägungen oder zugrunde liegenden Erkrankungen können gezielte physiotherapeutische Maßnahmen oder operative Eingriffe erforderlich sein.
Das innenrotierte Gangbild bei Kindern ist in den meisten Fällen eine harmlose Normvariante, die keine Behandlung erfordert. Eltern können beruhigt sein, da Intoeing selten mit ernsthaften Problemen verbunden ist und sich oft von allein verwächst. Sollte dennoch Unsicherheit bestehen, stehen wir Ihnen in unserer Praxis für eine fachkundige Untersuchung und Beratung gerne zur Verfügung.
Ellenbogenverletzungen beim Klettersport: Ursachen, Diagnostik und Prävention
Der Klettersport erfreut sich wachsender Beliebtheit und fordert den gesamten Bewegungsapparat durch seine dynamischen und oft unvorhersehbaren Bewegungen. Dabei gehört der Ellenbogen zu den besonders beanspruchten Gelenken, da er sowohl Kraft als auch Stabilität bei Griff- und Haltebewegungen gewährleisten muss. Ellenbogenverletzungen sind bei Kletterern häufig und können die sportliche Aktivität erheblich beeinträchtigen.
Kletterellenbogen (Mediale Epikondylitis)
Tennisellenbogen (Laterale Epikondylitis)
Sehnenentzündungen und -reizungen
Kompressionsverletzungen des Nervus ulnaris
Akute Verletzungen wie Luxationen oder Frakturen
Eine präzise Diagnose ist entscheidend, um die passende Behandlung einzuleiten. Neben der klinischen Untersuchung kommen bildgebende Verfahren wie Röntgen (bei Verdacht auf Frakturen) und MRT (zur Beurteilung von Weichteilschäden) zum Einsatz.
Ellenbogenverletzungen sind eine häufige Herausforderung für Kletterer, die sowohl durch Überbelastung als auch durch akute Ereignisse entstehen können. Mit einer präzisen Diagnostik, gezielter Behandlung und konsequenter Prävention können jedoch viele Verletzungen vermieden oder erfolgreich therapiert werden. Bei anhaltenden Beschwerden ist eine frühzeitige Vorstellung in unserer orthopädischen Praxis ratsam, um langfristige Einschränkungen zu vermeiden. Wir helfen Ihnen gerne, Ihre Kletterziele gesund und schmerzfrei zu erreichen!
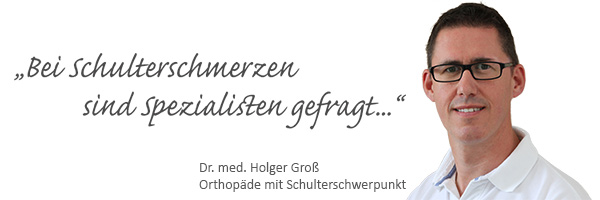
In Deutschland leiden etwa 12% aller Menschen gelegentlich oder dauernd an Schulterschmerzen. Wie einschränkend solche Beschwerden sind, kann meist nur der richtig einschätzen, der selbst davon betroffen ist. Diagnosen wie Kalkschulter oder Impingement sind Volkskrankheiten.
Die große Bewegungsfreiheit der Hand, die wir zum „Begreifen“ unserer Umwelt einsetzen können, beruht auf einem komplexen Aufbau des Schultergelenkes. Nur wenn das Schultergelenk gut funktioniert, können wir mühelos an Gegenstände gelangen, die sich vor, neben, hinter, unter oder über uns befinden.
Der komplexe Aufbau der Schulter und die sich schnell verändernde Erkenntnisse zu Erkrankungen und Therapie sind eine Herausforderung für jeden Arzt. Bei keinem anderen Gelenk haben sich in den letzten Jahren die Erkenntnisse über anatomische und funktionelle Zusammenhänge so sehr gewandelt wie an der Schulter. Viele Erkrankungen an der Schulter werden heutzutage vollständig anders gesehen als noch vor wenigen Jahren.
Diese neuen Erkenntnisse sind es auch, die uns zeigen, dass eine frühzeitige Diagnosestellung mit entsprechender Therapie unumgänglich ist, um Verschlechterungen oder schwere Folgeerkrankungen wie Sehnenrisse zu verhindern.
Gerade die frühzeitige Diagnosestellung durch den Fachmann ermöglicht oftmals noch eine Therapie ohne die Notwendigkeit aufwendiger operativer Eingriffe.
 Das Schulterzentrum Saar, das von unserer Praxis aufgebaut wurde, hat das Ziel durch Kooperation von Ärzten verschiedener Fachrichtungen wie z.B. Orthopäden, Radiologen und Neurologen sowie Physiotherapeuten eine schnellere Diagnostik und Therapie von Schultererkrankungen zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Kommunikation zwichen den einzelnen Diagnostik- und Therapiepartnern zum Wohle des Patienten verbessert werden.
Das Schulterzentrum Saar, das von unserer Praxis aufgebaut wurde, hat das Ziel durch Kooperation von Ärzten verschiedener Fachrichtungen wie z.B. Orthopäden, Radiologen und Neurologen sowie Physiotherapeuten eine schnellere Diagnostik und Therapie von Schultererkrankungen zu ermöglichen. Gleichzeitig soll die Kommunikation zwichen den einzelnen Diagnostik- und Therapiepartnern zum Wohle des Patienten verbessert werden.
Durch die Kooperation mit anderen namenhaften Spezialisten auf dem Gebiet der Schulterchirurgie, koordiniert das Schulterzentrum Saar die Mit- und Weiterbehandlung unserer Patienten.
Unsere Praxis hat sich bereits seit mehreren Jahren auf die Diagnostik und Behandlung von Schultererkrankungen spezialisiert. Ein enger Kontakt zu den Entwicklern medizinischer Systeme und ein intensiver Austausch mit anderen spezialisierten Kollegen ist notwendig, um jederzeit die neusten Erkenntnisse in die Diagnostik und Behandlung einfließen zu lassen.
Zur speziellen Diagnostik verfügen wir über ein hochauflösendes 14 MHz 3-D Ultraschallgerät und ein Oberflächen EMG. Mit dieser nur in wenigen Zentren verfügbaren Technik können auch komplexe Probleme diagnostiziert werden.
Sollte eine Operation unumgänglich sein, können Sie sich auf unsere grosse Fachkompetenz und operative Erfahrung verlassen. Jährlich werden von uns mehr als 400 operative Eingriffe am Schultergelenk durchgeführt. Um auch komplexe Eingriffe minimalsinvasiv durchzuführen, verfügen wir über eigenes modernes Operationsinstrumentarium für die Schulterchirurgie.
Unseren Patienten bieten wir somit eine spezialisierte Diagnostik und Therapie aus einer Hand.

